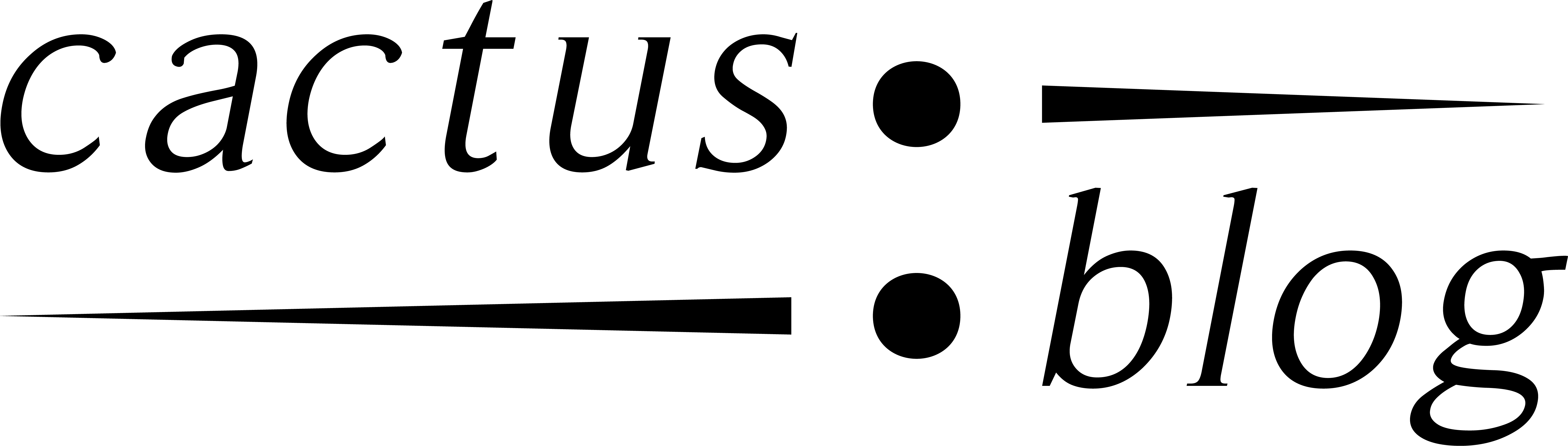Nach einem Leak über ein mutmaßliches Kriegsverbrechen durch US-Streitkräfte im Jahr 2007 in Bagdad, Afghanistan, wird der Journalist und Aktivist Julian Assange Ziel einer jahrelangen politischen Hetzjagd durch die US-Regierung, in Zusammenarbeit mit anderen Nationalstaaten. Nach seiner Verhaftung in Großbritannien im April 2019 droht ihm die Auslieferung an die Vereinigten Staaten, sowie 175 Jahre Haft. Ein Bericht über eine beispiellose politische Verfolgung.
12. Juli 2007 in Bagdad. Eine Gruppe teils bewaffneter Männer in Zivil wird durch die Bordkanone eines Helikopters der US-Armee erschossen. Unter ihnen befinden sich auch zwei Kriegsberichterstatter der Nachrichtenagentur Reuters. Wenig später erscheint ein Minibus, dessen Insassen den Verwundeten helfen möchten. Auch auf diesen Bus wird das Feuer eröffnet, es sterben weitere Menschen, außerdem wurden auch ein fünf- sowie zehnjähriges Kind, die auf dem Weg in die Schule waren, schwer verletzt.
Bei diesem Zwischenfall wurden mindestens 12 Menschen getötet. Die genaue Anzahl der Todesopfer bleibt umstritten.
Laut US-Militär wird später ein automatisches Gewehr, ein Raketenwerfer mit zwei Schuss, sowie die beiden Kameras der Journalisten geborgen.
Am 5. April 2010 veröffentlichte die Enthüllungsplattform WikiLeaks das Video der Tötungen unter dem Namen “Collateral Murder”. Der Whistleblower, der das Video an WikiLeaks sendete, Bradley Manning (heute Chelsea Manning), wurde im Mai des selben Jahres verhaftet und anschließend zu 35 Jahren Haft verurteilt. Manning wurde nach 7 Jahren vorzeitig entlassen.
Assange im Visier der USA und Schwedens
Nach den Leaks begannen die USA mit ersten Ermittlungen gegen WikiLeaks und Assange. Assange, australischer Staatsbürger und prominentestes Gründungsmitglied von WikiLeaks, sollte unter dem sogenannten “Espionage Act of 1917” angeklagt werden, einem Gesetz, das unter anderem auch die Todesstrafe ermöglicht. Assange geriet auch ins Visier der Medien, die ihn unter anderem als Hacker, Terroristen und Verräter (obgleich Australier) bezeichneten. Allerdings erhoben die USA zu diesem Zeitpunkt noch keine Anklage gegen Assange.
Zur gleichen Zeit sah sich Assange mit Vorwürfen aus Schweden konfrontiert, wo ihm sexuelle Nötigung und ein minderschwerer Fall von Vergewaltigung vorgeworfen wurde.
Die schwedische Staatsanwaltschaft erließ am 27. September 2010 einen Haftbefehl gegen Assange, der gerade auf dem Weg nach Berlin war. Die schwedischen Behörden ließen ihn trotzdem ausreisen. Sein Gepäck, laut Assange drei verschlüsselte Laptops und diverse Festplatten, verschwand und kam nicht in Berlin an. Es wurde bis heute nicht gefunden.
Im November 2010 erließ die schwedische Staatsanwaltschaft einen internationalen Haftbefehl gegen Assange, einen Monat später ließ Interpol per “Red Notice” nach Assange fahnden. Eine solche “Red Notice” wird im Regelfall für angeklagte oder verurteilte Straftäter erlassen wird. Im Fall von Assange gab es jedoch nicht einmal eine Anklage.
Assange befand sich während dieser Zeit in London, wo er sich am 7. Dezember 2010 der Polizei stellte und nach einer Woche gegen Kaution freigelassen wurde. Es folgte ein zweijähriger Rechtsstreit, da die schwedische Staatsanwaltschaft darauf bestand, dass Assange nach Schweden ausgeliefert werden solle. Eine Befragung von Assange in Großbritannien lehnte Schweden dezidiert ab. Auch eine Sicherheitsgarantie, ihn nicht an die USA auszuliefern, wollte der schwedische Staat nicht geben. Assange fürchtete ein sogenanntes “temporary surrender”, eine Auslieferung im Schnellverfahren, die Teil eines Abkommens zwischen den USA und Schweden ist.
Das britische Höchstgericht entschied schließlich, dass Assange am 28. Juni 2012 von Großbritannien aus nach Schweden ausgeliefert werden dürfe.
Am 19. Juni 2012 floh Assange aus Angst vor einer möglichen schwedischen Auslieferung an die USA in die ecuadorianische Botschaft in London, die er fast sieben Jahre nicht mehr verlassen sollte.
Botschaftszeit
Assange beantragte in der ecuadorianischen Botschaft Asyl aufgrund politischer Verfolgung. Durch seine Flucht in die Botschaft verletzte Assange die Kautionsauflagen Großbritanniens, wodurch ihm eine Festnahme drohte, sollte er die Botschaft verlassen. Als Grund für das Asylansuchen in Ecuador gab Assange an, dass er vom australischen Staat keinen Schutz erwarte.
Im August 2012 wurde Assange vom Staat Ecuador politisches Asyl gewährt. Als Begründung wurde die Gefahr durch beginnende US-Ermittlungen gegen Assange genannt. Großbritannien drohte Ecuador, die Botschaft gegebenenfalls zu stürmen und Assange verhaften zu wollen, falls Ecuador nicht kooperiert. Die Drohung wurde allerdings aufgrund politischer Brisanz wieder zurückgezogen. Festzuhalten ist, dass Großbritannien Assange ausschließlich einen Kautionsverstoß vorwerfen konnte.
Vom Juni 2012 bis Oktober 2015 umstellte Großbritannien die Botschaft Ecuadors Tag und Nacht, um Assange zu verhaften, sollte er das Botschaftsgelände verlassen. Die Kosten für diesen dreijährigen Einsatz beliefen sich auf 12,6 Millionen britische Pfund.
Im Jahr 2019 wurde bekannt, dass Assange während seiner Zeit in der Botschaft überwacht und ausspioniert wurde. UC Global, ein spanisches Sicherheitsunternehmen, das von der ecuadorianischen Botschaft für die Sicherheit beauftragt wurde, hat jahrelang Bild- und Tonmaterial an die US Behörde Central Intelligence Agency (CIA) übermittelt. Betroffen waren neben Assange selbst seine Ärzte und Anwälte sowie drei Mitarbeiter des Norddeutschen Rundfunks (NDR). Im November 2019 erstattete der NDR Anzeige gegen UC Global. Ein Urteil ist noch ausständig.
Assange wurde im Dezember 2017 die Staatsbürgerschaft Ecuadors verliehen. Insgesamt lebte Assange sechs Jahre und zehn Monate in der Botschaft, in dem ein ehemaliges Büro zu einer kleinen Wohnung umfunktioniert wurde.
Nach den Wahlen in Ecuador im Mai 2017 kam es zu einem Paradigmenwechsel im Fall Assange. Der neue Präsident Moreno, bedacht auf eine Verbesserung der US-Beziehungen zu Ecuador und unter Aussicht auf Zusagen von Krediten durch den Internationalen Währungsfond – mit den USA als stimmenstärkste Partei – wendet sich zusehends von Assange ab.
Am 11. April 2019 wurde Julian Assange die ecuadorianische Staatsbürgerschaft entzogen. Als Begründung wurden Unregelmäßigkeiten bei den Papieren genannt. Es gab kein rechtsstaatliches Verfahren. Die Polizei Großbritanniens betrat auf Einladung der ecuadorianischen Botschaft das Gelände und verhaftete Assange. Seine persönlichen Gegenstände wurden von Ecuador an die USA ausgehändigt.
Eine Stunde nach seiner Verhaftung reichten die USA ein bisher geheim gehaltenes Auslieferungsansuchen an Großbritannien ein.
Isolationshaft in London
Noch am selben Tag wurde Assange in London vor Gericht gestellt und nach 15-minütiger Verhandlung wegen Kautionsverstößen zu 50 Wochen Haft verurteilt und ins Hochsicherheitsgefängnis HMP Belmarsh überstellt. Wegen des anhängigen Auslieferungsgesuchs der USA wurde Assange danach nicht entlassen.
Assange muss 23 Stunden des Tages in seiner Einzelzelle verbringen und darf diese nur für eine Stunde verlassen, allerdings nicht ins Freie. Er darf zwei Besucher pro Monat empfangen und hat weder Zugang zum Internet, einem Computer oder der Bibliothek.
Nils Melzer, UN-Sonderberichterstatter für Folter, besuchte mit zwei Ärzten Assange im Mai 2019. Er warf den USA und seinen Verbündeten “kollektive Verfolgung” und “weiße Folter” vor: “Assange wies während unseres Besuches in Belmarsh die für die Opfer psychischer Folter typischen Symptome auf, darüber gab es keinen Zweifel”.
Melzer betonte, dass die Misshandlung Assanges den Zweck der Abschreckung Anderer hat.
Aufgrund der Covid-19 Pandemie wurden Gerichtstermine abgesagt und verschoben, die letzte Verhandlung findet im Februar 2024 statt. Während dieser Zeit muss Assange weiter in Haft bleiben.
Folgen einer Auslieferung an die USA
Die USA erweiterten das Auslieferungsgesuch im April 2019 um weitere 17 Punkte unter dem “Espionage Act of 1917”. Angeklagt wird Assange unter anderem wegen Spionage, Anstiftung zur Verletzung der Geheimhaltungspflicht (gegenüber Manning) sowie Verbreitung geheimer Informationen. Insgesamt drohen Assange damit bis zu 175 Jahren Haft.
Anklagen nach dem “Espionage Act of 1917” werden am sogenannten “Espionage Court” in Alexandria, Eastern District of Virginia verhandelt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit und der Presse. Es wurde dort noch nie ein Angeklagter freigesprochen.
Nach einer möglichen Verurteilung droht Assange Isolationshaft in einem Hochsicherheitsgefängnis der USA sowie “Special Administrative Measures (SAM)”, verschärfte Haftanordnungen, die formell keine Strafen der Justiz sind, sondern Sicherheitsmaßnahmen seitens der Regierung.
Diese SAMs umfassen Maßnahmen wie Kontaktverbot zu Familienmitgliedern, Verbot von Büchern und Zeitungen, Zwangsernährung bei Hungerstreiks und erweiterte Isolationshaft, bei der Häftlinge monatelang keinen Kontakt zu anderen Menschen haben.
Aktueller Stand
Am 21. Februar 2024 entscheidet der High Court in Großbritannien, ob Assange an die USA ausgeliefert wird oder weitere Rechtsmittel einlegen darf. Sollte das Gericht gegen Assange entscheiden, bliebe ihm noch eine Anrufung des europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), um eine mögliche Auslieferung zu verhindern.
Im Fall der im Video “Collateral Murder” gezeigten Tötungen kam es zu keiner Anklage gegen die ausführenden Soldaten.
Die schwedischen Ermittlungen wurden am 19. November 2019 im Stadium der Voruntersuchung eingestellt. Es kam nie zu einer Anklage.
Julian Assange sitzt bis heute in Isolationshaft im HMP Belmarsh.
Update
Nach über fünf Jahren in Haft kam es zu einem Deal zwischen Julian Assange und den Vereinigten Staaten. Am 25. Juni 2024 verließ Assange Großbritannien und flog auf die Insel Saipan, einem US-Außengebiet im pazifischen Ozean.
Dort stellte er sich am 26. Juni einem Gericht, bei dem er sich für die Beschaffung und Weitergabe von Informationen betreffend der nationalen Sicherheit schuldig bekannte. Er wurde direkt zu 62 Monaten Haft verurteilt, die er bereits in Großbritannien verbüßt hatte, und durfte als freier Mann nach Australien ausreisen.